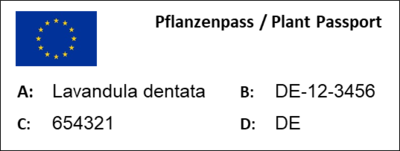Feuerbrand ist eine durch das Bakterium Erwinia amylovora verursachte Krankheit an Pflanzen aus der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Das Auftreten dieser Krankheit war in Deutschland seit den 1980er Jahren meldepflichtig. Durch eine EU-weite gesetzliche Neuregelung ist die Meldepflicht nun seit Ende 2019 entfallen. Dennoch können behördliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit angeordnet werden, falls dies zum Schutz weiterer Kulturen erforderlich ist.

Nach einer Infektion verfärben sich Blüten und Blätter rötlich-braun (bei Apfel) bis schwarz (bei Birne) und werden ledrig. Infizierte junge Triebe werden schwarz und zeigen hakenförmige Verkrümmungen. Bei feuchtwarmer Witterung sind farblose bis bernsteinfarbene Schleimtropfen an befallenen Zweigen sichtbar. Zu beobachten sind diese typischen Symptome der Neuinfektionen meist ab Mitte Juni.
Bei etabliertem Befall können am Stamm oder auf den Ästen eingesunkene schwarze Stellen erkennbar sein, sogenannte “Canker“. Bei massivem Befall können auch die Früchte befallen werden. Aus den Cankern oder den Früchten können unter entsprechenden Witterungsbedingungen ebenfalls Schleimtropfen austreten.
Ein Merkblatt für den Haus- und Kleingarten zu diesem Thema mit ausführlichen Informationen zur Biologie des Erregers und zu Maßnahmen sowie mit weiteren Fotos finden Sie als PDF-Datei zum Herunterladen im Anhang.
Zusätzliche Informationen bietet auch das Julius-Kühn-Institut unter JKI: Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau - Feuerbrand (julius-kuehn.de).
Pflanzenschutz-Hotline: Tel.: 0441 801 789
Mitte März bis Ende September
dienstags von 10 -12 Uhr